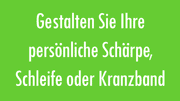Tipps für das Gartenjahr von und bei Floristik24
Erfahrene Hobbygärtner können bestätigen, dass man rund ums Jahr immer etwas im Garten zu tun hat. Im Frühling muss gesät und gepflanzt werden, im Sommer benötigen die Pflanzen viel Wasser, man sollte kräftig Unkraut jäten und auch die Gartenfeste nicht vergessen. Im Herbst steht dann die erfolgreiche Erntezeit an: Gemüse und Obst müssen geerntet werden, Kräuter wollen getrocknet werden, Kompost wird ausgebracht und neu aufgeschichtet, teilweise können die Beete schon umgegraben und für das kommende Jahr vorbereitet werden, Sträucher, Bäume und Pflanzen sollten beschnitten, falls die Pflanzenart keinen Frühjahrsschnitt erfordert. Gemüse wird eingelagert, auch Gartenmöbel und Geräte müssen gereinigt und frostsicher verstaut werden. Vor dem Winter muss der Rasen nochmals gemäht werden, Wassergefäß sollten entleert und gereinigt werden, frostempfindliche Pflanzen müssen vor Kälte und Schnee geschützt werden. Auch die Kübelpflanzen dürfen nicht vergessen werden; sie werden meist ins Haus gebracht.
So hält jede Jahreszeit für den Gärtner ganz spezielle Arbeiten in seinem Garten bereit. In jedem Monat zeigt die Natur ein anderes Gewand, stellt neue Anforderungen und birgt neue Überraschungen. Wie wir uns im Frühjahr über die ersten Sonnenstrahlen, Schneeglöckchen und Krokusse freuen, so lieben Gärtner die Sommernatur mit Schmetterlingen, Bienen und anderen Gartentieren, mit dem ersten Rupfsalat und frischen, selbst gepflückten Erdbeeren. Endlos schön zeigt sich der Spätsommer bis in den Herbst mit frischem Obst und Gemüse, sattgrünen Bäumen und einem bunten Blumenmeer bis dann die Erntezeit ansteht und die Vorräte eingelagert werden müssen. Erst im Winter, wenn der Raureif morgens auf den Gräsern liegt und der erste Schnee Stauden und Bäume bedeckt, dürfen Gärtner ein wenig ausruhen.
Wir zeigen Ihnen in unserem Gartenkalender, welche Arbeiten zu welcher Jahreszeit bzw. in welchem Monat verrichtet werden sollten. Insbesondere Gartenanfänger sind oft unsicher, wenn es um Fragen wie mulchen, Insektenschutz, Wintervögel, Beerensorten, Beetplanung und vieles mehr geht. Mit dem Gartenkalender haben Anfänger, Fortgeschrittene wie auch versierte Hobbygärtner immer praktische Tipps zur Hand, verständlich erklärt und leicht umsetzbar.
Besuchen Sie auch unseren Floristik-Online-Shop.
 Rebdraht
Rebdraht
 Unser nur 0,55 mm dicke Rebbindedraht wurde sorgfältig verkupfert und dann mit braunem Papier umwickelt, um Ihren Kletterrosen und Rankgewächsen einen sicheren, aber unauffälligen Halt zu verpassen. Als universell einsetzbare Pflanzhilfe, kann unser Rebdraht auch Ihren Stauden und ähnlichen Pflanzen die benötigte Festigkeit geben. Die Kilorolle mit ca. 250 m Rebdraht ist ein praktisches Spargebinde für jeden Gärtner und Gartenfreund.
Unser nur 0,55 mm dicke Rebbindedraht wurde sorgfältig verkupfert und dann mit braunem Papier umwickelt, um Ihren Kletterrosen und Rankgewächsen einen sicheren, aber unauffälligen Halt zu verpassen. Als universell einsetzbare Pflanzhilfe, kann unser Rebdraht auch Ihren Stauden und ähnlichen Pflanzen die benötigte Festigkeit geben. Die Kilorolle mit ca. 250 m Rebdraht ist ein praktisches Spargebinde für jeden Gärtner und Gartenfreund.
 Kräutererde
Kräutererde
 Gartenkräutern und Würzkräutern verleiht unsere Kräutererde aus dem Hause FRUX die notwendigen Nährstoffe für eine erfolgreiche Anzucht und Kultivierung. Dank der voll biologischen Aufdüngung, ist die Kräutererde auch völlig unbedenklich für die Anzucht nach biofreundlichen Kriterien geeignet. Das 10 kg Gebinde in der Tüte ist perfekt für eine Hobbyzucht im heimischen Kräuterbeet oder auch für topfbasierende Aufzuchtformen.
Gartenkräutern und Würzkräutern verleiht unsere Kräutererde aus dem Hause FRUX die notwendigen Nährstoffe für eine erfolgreiche Anzucht und Kultivierung. Dank der voll biologischen Aufdüngung, ist die Kräutererde auch völlig unbedenklich für die Anzucht nach biofreundlichen Kriterien geeignet. Das 10 kg Gebinde in der Tüte ist perfekt für eine Hobbyzucht im heimischen Kräuterbeet oder auch für topfbasierende Aufzuchtformen.
 Kräuterdünger
Kräuterdünger
 Erfolgreiche Kräuterzüchter wissen längst, dass den Bedürfnissen der Kräuter auch Rechnung getragen werden sollte. Unser Kräuterdünger mit der cleveren und integrierten Dosierhilfe, deckt den Grundbedarf Ihrer Kräuter umfassend und eignet sich daher auch hervorragend für Kultivierungsformen in Pflanzcontainern oder Töpfen. Von März bis in den Oktober einsetzbar, ist der Kräuterdünger ein echter Garant für wohlschmeckende Gartenkräuter.
Erfolgreiche Kräuterzüchter wissen längst, dass den Bedürfnissen der Kräuter auch Rechnung getragen werden sollte. Unser Kräuterdünger mit der cleveren und integrierten Dosierhilfe, deckt den Grundbedarf Ihrer Kräuter umfassend und eignet sich daher auch hervorragend für Kultivierungsformen in Pflanzcontainern oder Töpfen. Von März bis in den Oktober einsetzbar, ist der Kräuterdünger ein echter Garant für wohlschmeckende Gartenkräuter.
 Gartenschere
Gartenschere
 Nicht immer sind Großmodelle von Gartenscheren das wirklich passende Gerät für Arbeiten an Pflanzen. Oftmals kann eine kleinere und leichtere Floristenschere die zu erledigenden Arbeiten mit weniger Kraftaufwand viel müheloser bewältigen. Unsere leichte Gartenschere zeichnet sich dafür besonders aus, denn der sichere Griff und die gut befestigte Feder ergänzen sich mit dem Sicherungsclip und auch dem Aufhängebügel zu einem alltagstauglichen Kleingerät, welches auch den gärtnernden Damen gut in der Hand liegt.
Nicht immer sind Großmodelle von Gartenscheren das wirklich passende Gerät für Arbeiten an Pflanzen. Oftmals kann eine kleinere und leichtere Floristenschere die zu erledigenden Arbeiten mit weniger Kraftaufwand viel müheloser bewältigen. Unsere leichte Gartenschere zeichnet sich dafür besonders aus, denn der sichere Griff und die gut befestigte Feder ergänzen sich mit dem Sicherungsclip und auch dem Aufhängebügel zu einem alltagstauglichen Kleingerät, welches auch den gärtnernden Damen gut in der Hand liegt.
 Gießkanne
Gießkanne
 Die Gießkannen im praktischen 5 bis 10 l Bereich aus unserem Hause sind nicht nur sehr preiswert, sondern auch hochgradig funktionell und formschön. Die richtige Gießkanne ist das ideale Objekt, um eine dosierte Menge an Wasser an eine bestimmte Stelle sehr zielgenau zu bringen. Durch einfache Neigung des Halses nach unten, fließt das Wasser aus dem Vorratsbehälter heraus. Ein Sprengaufsatz kann die abfließende Wassermenge dann zu einem weichen Guß verteilen.
Die Gießkannen im praktischen 5 bis 10 l Bereich aus unserem Hause sind nicht nur sehr preiswert, sondern auch hochgradig funktionell und formschön. Die richtige Gießkanne ist das ideale Objekt, um eine dosierte Menge an Wasser an eine bestimmte Stelle sehr zielgenau zu bringen. Durch einfache Neigung des Halses nach unten, fließt das Wasser aus dem Vorratsbehälter heraus. Ein Sprengaufsatz kann die abfließende Wassermenge dann zu einem weichen Guß verteilen.